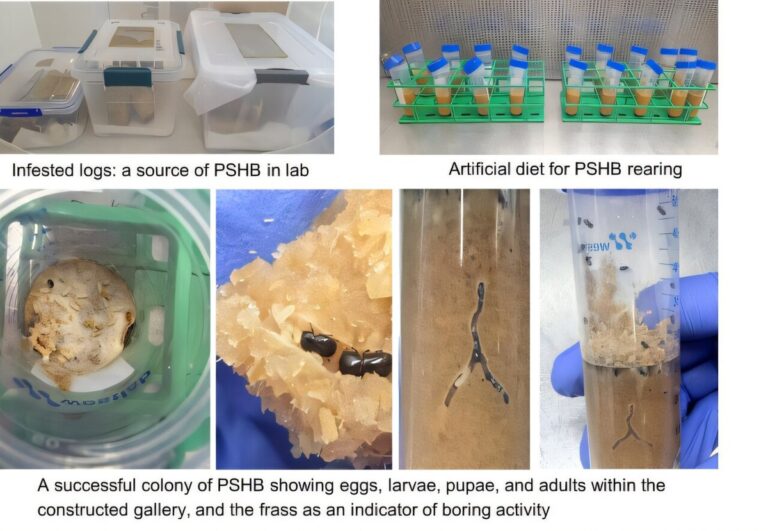In einer Höhle zwischen Albanien und Griechenland haben Wissenschaftler eine spektakuläre Entdeckung gemacht: ein Netz von 106 Quadratmetern, das von fast 111.000 Spinnen gewebt wurde.
In der „Schwefelhöhle“ untersuchen Höhlenforscher die zahlreichen übereinanderliegenden Schichten von Netzen, die die Wände der Höhle bedecken und Zehntausende von Spinnen beherbergen.
Empfindliche Wesen sollten den Artikel besser nicht weiterlesen. Ob man von Spinnen erschreckt, angeekelt oder fasziniert ist, es wird schwierig sein, gleichgültig gegenüber der Entdeckung zu bleiben, die von Wissenschaftlern und Höhlenforschern an der Grenze zwischen Albanien und Griechenland, im Herzen der „Schwefelhöhle“, gemacht wurde. In dieser dunklen Höhle, die von einem starken Geruch nach faulen Eiern durchdrungen ist, hervorgerufen durch das enthaltene Schwefelwasserstoffgas, fanden die Forscher eine außergewöhnliche natürliche Struktur: Tausende von Netzen breiten sich über mehr als einhundert Quadratmeter aus und beherbergen etwa 111.000 Spinnen, was mehr als tausend Individuen pro Quadratmeter bedeutet!
Zusammenleben in einer Höhle
Christine Rollard, Arachnologin und Dozentin am Muséum national d’Histoire naturelle in Paris, betont, dass es sich nicht um ein einzigartiges riesiges Netz, sondern um „eine Verflechtung einzelner Netze“ handelt. „Was spektakulär ist, ist diese Verkettung, die einen Belag, ein Gewebe, einen Schleier schafft“, beschreibt sie. Solche Ansammlungen können manchmal in der Natur erscheinen, aber die hier beobachtete Ansammlung bleibt außergewöhnlich, da die Spinnen zahlreich und an derselben Stelle versammelt sind. Jean-François Flot, Professor für evolutionäre Biologie an der Université libre de Bruxelles und Mitglied des wissenschaftlichen Teams, das an der Studie beteiligt war, war ebenfalls von der Ausdehnung der Struktur und ihrer überraschend weichen Textur beeindruckt. „Es erinnerte mich an die Papiernester, die von bestimmten Wespen hergestellt werden“, erzählt er.
Unter den zahlreichen Spinnen in der Höhle dominieren zwei Arten, Tegenaria domestica und Prinerigone vagans. „Beide weben Flächennetze, und die Tégénaire [fügt] einen Trichter hinzu, die Löcher, die auf den Bildern zu sehen sind“, erklärt Christine Rollard. Die Wissenschaftlerin bemerkt jedoch, dass die beobachtete Struktur sich leicht von den normalerweise von Tégénaires gebauten unterscheidet. „Normalerweise bauen Tégénaires ein echtes Netz [gerichtet] nach vorne. Hier scheint das Netz mehr auf die Wand gepresst zu sein, was mich überraschte. Es bildet eine Art Schleier“, sagt sie.
Bei Tageslicht lebt Tegenaria domestica allein und kann sogar Prinerigone vagans jagen. Ihr friedliches Zusammenleben in der Höhle hat die Forscher also fasziniert. Jean-François Flot äußert mehrere Hypothesen, um dies zu erklären. Er schätzt, dass „die Dunkelheit und die Nahrungsfülle die Aggressivität der Spinnen verringern und ihr Zusammenleben fördern könnten“. Er erwähnt auch die Anpassung an die unterirdische Umgebung, die mit genetischen Unterschieden verbunden sein könnte, die ihr Verhalten verändern. Zudem könnte auch eine Veränderung des Mikrobioms eine Rolle spielen, da immer mehr Studien einen „starken Zusammenhang zwischen Mikrobiom und Verhalten bei vielen Tieren herstellen“.
Trotz des Eindrucks eines gemeinsamen Netzes bleibt jede Spinne tatsächlich in ihrer eigenen Struktur. „Sie bilden ein Ganzes, da die Netze sehr dicht beieinander liegen, aber ich denke, dass die Spinnen einsam geblieben sind“, präzisiert Christine Rollard. Sie weist darauf hin, dass wahrscheinlich Kämpfe während der Konstruktion stattgefunden haben, wobei einige Tégénaires oder Linyphiiden sich möglicherweise gegenseitig gefressen haben. „Aber einmal [installiert], blieben sie jeweils in ihrem Netz. […] Ihr Netz ist ihr Territorium. Es sind Spinnen, die auf ihre Beute warten und sich nicht bewegen“, betont sie.
Ein rauer, dunkler und feuchter Lebensraum
Laut der Studie erklärt die außerordentliche Fülle an Nahrung größtenteils die Anwesenheit und die ungewöhnliche Konzentration von Spinnen in der Höhle. Die Wissenschaftler beobachteten riesige Schwärme von Chironomiden, diesen nicht stechenden Mücken, von denen sich die Spinnen ernähren. Diese Insekten sind ihrerseits von Biofilmen abhängig, die von Bakterien produziert werden, die in der Lage sind, Schwefel zu oxidieren. Dank eines Baches, der reich an Schwefelwasserstoff ist und die Höhle durchquert, proliferieren diese Mikroorganismen und speisen die gesamte Nahrungskette. „In den normalen Lebensräumen und Ökosystemen dieser beiden Arten gibt es kein Schwefel“, erinnert Christine Rollard.
Die Bedingungen in der Höhle entsprechen zudem perfekt ihrem natürlichen Lebensraum. Tégénaires sind beispielsweise nachtaktiv, und „es ist völlig normal, sie an dunklen Orten zu finden“, erklärt die Spezialistin. „Tagsüber bleiben sie in ihrem Trichter. Und beim Einbruch der Nacht stellen sie sich immer auf ihr Netz, die Beine ausgestreckt am Eingang des Trichters, auf dem Belag, der die Falle bildet.“ Diese beiden Arten suchen auch „eine gewisse Feuchtigkeit und eine eher kühle Temperatur“, Parameter, die die Höhle ihnen natürlich bietet.
„Ein solches chemosynthetisches Ökosystem ist vergleichbar mit dem, was man an ozeanischen Rücken findet, aber viel zugänglicher“, betont Jean-François Flot. „Der Zugang zur Höhle ist relativ einfach, auch wenn man einen Fluss mit ziemlich starkem Strom überqueren muss, und die Organismen leben bei normalen Temperaturen und Druckverhältnissen, weshalb es einfach ist, sie lebend ins Labor zu bringen, um sie zu studieren.“ Der Forscher betont zudem die Notwendigkeit, diesen einzigartigen Standort zu schützen. „Es ist absolut entscheidend, diese einzigartige Höhle auf der Welt zu bewahren, und wir denken bereits über geeignete Maßnahmen nach.“
Christine Rollard weist schließlich auf die bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit der Spinnen hin. „Sie sind dafür gemacht, extreme Umgebungen zu kolonisieren“, erklärt sie. „Man findet sie wirklich überall“. Einige Arten können somit „in 6.700 Metern Höhe im Himalaya in Spalten leben“, während andere Wüsten oder extrem feuchte Umgebungen besetzen, wo die Temperaturschwankungen erheblich sein können.
Ergebnisse weiter verfeinern
In dieser Studie konzentrierte sich das Team von Professor Jean-François Flot auf zwei Hauptaspekte: die DNA-Sequenzierung der Spinnen aus der „Schwefelhöhle“, entnommen vom Netz und in der Nähe des Eingangs, sowie die Analyse des Mikrobioms von Tegenaria domestica. „Die genetischen Analysen zeigten, dass die beiden Spinnenarten, die friedlich auf dem riesigen Netz koexistieren, genetisch voneinander verschieden, jedoch den bisher sequenzierten Oberflächenpopulationen nahestehen. Dies legt nahe, dass die in der Höhle beobachteten Populationen dieser beiden Arten keinen Austausch von Individuen mit den Oberflächenpopulationen dieser gleichen Arten haben“, erklärt er.
Diese genetischen Unterschiede zeugen von einer alten Trennung zwischen den unterirdischen Populationen und denen, die an der Oberfläche leben. „Um [das Alter dieser Trennung] erfahren zu wollen, müssen wir das gesamte Genom von Oberflächenindividuen und den Individuen der Höhle sequenzieren, um sie zu vergleichen“, führt der Forscher weiter aus. Verhaltensstudien sind ebenfalls geplant, um die beiden Gruppen in derselben Umgebung zu beobachten.
Das Alter des Netzes bleibt ebenfalls unbekannt. „Was das Alter des Netzes betrifft, müssen wir Proben von dem Teil, der dem Wand am nächsten ist, wo das Netz sehr dick und somit logisch am ältesten ist, entnehmen und es mittels Kohlenstoffisotopen datieren“, betont Jean-François Flot.
Schließlich zeigt die Analyse des Mikrobioms, dass das Mikrobiom der Tégénaires in der Höhle stark verarmt ist. „Dieses verarmte Mikrobiom deutet darauf hin, dass das Milieu, in dem die Tégénaires in der Höhle leben, ein sehr ‚sauberes‘, fast steriles Milieu im Vergleich zum Außenmilieu ist“. Die identifizierten Bakterien sind intrazelluläre Symbionten, deren außergewöhnliche Häufigkeit schwer zu interpretieren ist. „Es handelt sich also um ein vorläufiges Ergebnis“, präzisiert der Spezialist.
Spinnenseide, stärker als Stahl
Wie alle Spinnennetze werden die in der „Schwefelhöhle“ beobachteten aus einem bemerkenswerten Naturmaterial hergestellt: Spinnenseide. Diese wird im Abdomen des Tieres durch spezialisierte Drüsen produziert, die Proteine, sogenannte Spidroine, synthetisieren. Im Körper ist die Seide flüssig, dann festigt sie sich beim Durchgang durch kleine Öffnungen an der Rückseite des Körpers der Spinne. „Spinnen sind die einzigen Tiere, die mehrere Arten von Fäden für verschiedene Zwecke produzieren. Hier wurde einer dieser Fäden verwendet, um die Fallen zu bauen. Und das ist wirklich ein sehr widerstandsfähiges Material, besonders wenn es sich um eine [aufwändige] Konstruktion wie hier handelt“, erklärt Christine Rollard.
Die Spinnenseide gehört zu den robustesten Naturmaterialien der Welt. Spinnenseide soll stärker sein als Stahl und zäher als Kevlar. Ihre Eigenschaften inspirieren seit langem Forscher, insbesondere für biomimetische Anwendungen in der Textil- und Medizinbranche. „Der Biomimetismus existiert schon lange, und seit vielen Jahren suchen wir danach, Fäden aus Spinnenseide zu reproduzieren“, erinnert die Wissenschaftlerin.
Im 19. Jahrhundert, in Madagaskar, führten der Jesuitenpater Paul Camboué und sein Mitarbeiter, der Techniker M. Nogué, die ersten Versuche zur Gewinnung von Nephila-Seide durch, von großen Spinnen, deren Netze bis zu zwei Meter Durchmesser erreichen und kleine Vögel oder Fledermäuse fangen können. „Die Nephila aus Madagaskar spinnt schöne geometrische Netze. Sie hatten Hunderte von Individuen gezüchtet, die Fäden von der Rückseite der Spinne zogen, sie um eine Spindel wickelten und Stoffstücke herstellten“, beschreibt die Forscherin. Dieses Experiment wurde jedoch eingestellt. „Sie hörten auf, weil es im Vergleich zu der Seide der Seidenraupen nicht rentabel genug und viel anspruchsvoller in der Aufzucht war“, präzisiert sie.
Heute kommen die vielversprechendsten Fortschritte aus der Biotechnologie. „Aktuell sind die Deutschen am weitesten fortgeschritten in der Produktion von Fäden, die vergleichbare Eigenschaften wie Spinnenseide haben, mithilfe von Bakterien“, erklärt die Wissenschaftlerin und verweist insbesondere auf die Arbeiten des Unternehmens AMSilk.